Tschernobyl, 26.04.1986 – Mettingen, 26.04.2023
Im Rahmen des Projekts ,,Für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ wurde uns am Comenius-Kolleg Mettingen die Ehre zuteil, mit einem Überlebenden der Reaktorkatastrophe Tschernobyl im Jahr 1986 zu sprechen und uns seine Geschichte anzuhören.
Sein Name ist Anatoly Gudavew und er kommt aus Charkiw, einer Stadt im Osten der Ukraine, und wurde begleitet von den Projektleitern und seiner Übersetzerin.
Charkiw liegt im Grenzgebiet der Ukraine zu Russland, das mitunter am meisten vom Krieg betroffen ist. Er erzählt, wie vor dem Krieg 1.700.000 Menschen dort ihr Zuhause fanden, aufgrund der Tatsache, dass viele ihr Zuhause verlassen mussten, leben zwischenzeitlich nur noch circa 400.000 Einwohner dort.
Als am 26.4.1986 das Nuklearunglück geschah, erfuhren in Charkiw die meisten erst Tage später davon, da es erst unter Verschluss gehalten wurde. Anatoly Gudavew selbst, damals 25 Jahre alt und Ingenieur, erfuhr davon durch illegale Radiosender. Nichtsahnend kam er nach der Arbeit nach Hause und wenige Minuten später kamen auch schon Gesandte vom Staat mit einer offiziellen ,,Einladung“ – der Anweisung, er solle sich innerhalb von einer Stunde mit seinen Ausweisdokumenten an einem bestimmten Ort einfinden.
Mehr Informationen bekam er nicht.
Mehrere hundert Menschen kamen dorthin, wurden mit Militärkleidung ausgestattet und einen Bus verfrachtet. Da dämmerte es ihnen allmählich, wohin die Reise gehen sollte: Nach Tschernobyl. Jedoch nicht, wann es eine Rückreise geben würde, geschweige denn – ob überhaupt.
Er erinnert sich noch genau, wie er auf der Fahrt nach Kiew aus dem Busfenster sah und eine junge Familie erblickte, mit einer kleinen Tasche in einem zerbrechlichen Wagen, vermutlich genauso verloren wie er selbst. Wie die junge Familie waren auch die Trinkbrunnen mit Plastikfolien abgedeckt – das Wasser war vergiftet. Befremdliche Bilder, welche sich in seine Erinnerung einbrannten.
Dreißig Kilometer von dem Atomkraftwerk bauten sie ihr Lager auf. Zwei Tage lang bekamen sie einen Crashkurs von der Feuerwehr, in welchem sie das Nötigste auf die Schnelle lernen sollten – Zivilisten waren zu Feuerwehrleuten und zu sogenannten Liquidatoren geworden, Männer, die nach Tschernobyl aufräumen sollten.
Es war ein sehr warmes Jahr, allgemein war die Gegend um Kiew bekannt dafür, dass das Torfmoor durch die Hitze in Brand gesetzt werden konnte und eben diese Brände sollten sie löschen, sie versuchten es sogar mit Ästen und Schaufeln. Die lodernden Flammen sollten sich für immer in sein Gedächtnis brennen. Es bestand die Gefahr einzubrechen, schwarzer Rauch drang aus der Erde hinaus, man wusste nicht, wo das Epizentrum war. Mit seinen Worten malte er die Bilder in unserer Vorstellung: davon, wie die Männer die Radioaktivität auch von den Häusern abwaschen sollten, von dem atomaren grüngrauen Regen und den radioaktiven Wolken, welche sich überall absetzten. Als klar wurde, dass man die Strahlung nicht von den Häusern abwaschen konnte, wurden tiefe Löcher um die Häuser gegraben, um sie dann darin zu versenken.
Zwei Tage nach der Katastrophe spielten die Kinder noch unbefangen auf den Spielplätzen in Prypjat. Als den Menschen gesagt wurde, sie müssten für ein paar Tage ihre Häuser verlassen, ließen sie für die angedachte kurze Zeit all‘ ihre Habseligkeiten daheim. Dass es kein Zuhause mehr für sie geben würde, in das sie heimkehren könnten, wussten sie damals nicht. Ihr Zuhause wurde wortwörtlich begraben.
In der Nacht vom 23. und 24. Mai musste seine Truppe einen Brand am Atomkraftwerk selbst löschen, sie trugen Gummianzüge und Masken, die Radioaktivität war viel zu hoch. Sieben Minuten waren allerhöchstens vorgesehen, um mehrere Schläuche zu legen – die meisten brauchten jedoch eher fünfzehn Minuten, da sie durch die Anzüge unbeweglich waren. Die Masken zogen sie irgendwann aus, da sie schnell nass wurden und sie bei der Arbeit behinderten. Als sie endlich fertig waren und unter die Dusche gingen, schlief die Hälfte seiner Kameraden noch in den Duschen ein und wurden mit Tritten des Offiziers wieder geweckt. Wie er im Nachhinein erfuhr, konnten ihre Körper nicht mehr und brachen als Schutzreaktion nach der enormen Belastung der Strahlung einfach zusammen. Viele mussten sich auch übergeben. Die Hälfte seiner Kameraden kam direkt für mehrere Tage ins Krankenhaus. Die andere Hälfte musste in den nächsten Einsatz, um das ,,schwere“ Löschwasser abzupumpen.
Als ein Schüler fragte, ob denn die Technologien und Geräte defekt gewesen seien, die der Sowjetunion damals zugesandt wurden, antwortete er nachdenklich: ,,Nein, sie funktionierte. Aber durch die hohe Strahlung waren sie nach ein bis zwei Tagen bereits nicht mehr funktionstüchtig. Die einzigen, die die Katastrophe eindämmen konnten, waren die Menschen. Und da Menschenleben damals in diesem System ohnehin nichts wert waren, war die Antwort sehr klar.“
Insgesamt 35 Tage arbeiteten sie dort. Dann bekamen dann ihre Entlassungspapiere. Als Entlohnung bekamen sie einen Verdienstorden für treue Dienste für das Vaterland und das doppelte Gehalt ihrer vorherigen Arbeitsstelle. Alle gesundheitlichen Probleme, die sich aus ihrem Einsatz ergaben, durften jedoch nicht thematisiert werden. In den darauffolgenden fünf Jahren, war es jedem untersagt, Krankheiten auf die Reaktorkatastrophe zurückzuführen.
Ende der 1980-Jahre erlitt er selbst erste Anzeichen einer onkologischen Erkrankung. Zeitgleich gründete er in Charkiw eine Initiative für überlebende Liquidatoren, um diese medizinisch zu unterstützen und ihnen oder ihren Hinterbliebenen finanziell zu helfen. Als er Anfang der 1990er Jahre erstmals als Begleitperson einer betroffenen Kindergruppe nach Deutschland kam, wurde er dort untersucht und behandelt. Zwei Operationen in München sind laut ihm dafür verantwortlich, dass er heute noch leben darf.
Auch heute bereitet ihm die Situation in der Ukraine viele Sorgen: Der alte Sarkophag, die Schutzhülle um das Kraftwerk, die ursprünglich dazu gedacht war, 25 zu halten, aber Gudavews Meinung nach eher einen „Regenschirm“ darstellte, der neue Sarkophag, der uns vielleicht 100 Jahre lang vor dem atomaren Staub Tschernobyls bewahrt – vielleicht aber auch nicht, und der Kampf um das Atomkraftwerk in Saporischschja. Man habe leider keine Kontrolle darüber, was nun passieren würde: Der russische Energieminister habe gesagt, dass die Ukraine entweder Russland oder Asche werden würde – die atomare Katastrophe als Drohung, die bei Gudavew nur Kopfschütteln auslöste.
Anatoly Gudavews Mission ist es, auch den jüngeren Generationen klar zu machen, dass Atomkraft niemals eine Antwort sein sollte. Ein Gramm Plutonium reiche bereits dafür aus, damit eine Millionen Menschen sterben. Laut einem Experten gab es 17 Fehler in der Konstruktion, sieben davon so schwerwiegend gewesen, dass nur ein einzelner davon ausgereicht hatte, um die Katastrophe auszulösen. Sind wir heute vor einer ähnlichen Situation gefeit? Und was ist mit dem Atommüll, der uns noch Jahrtausende begleiten wird?
Bezeichnend, dass ein Wort seinen Vortrag dominierte: „к сожалению“, auf Deutsch: „leider“.
Vielen Dank an Herrn Gudavew und die Initiative für ihren Besuch!
Daniela Himmelfarb, 4.Semester
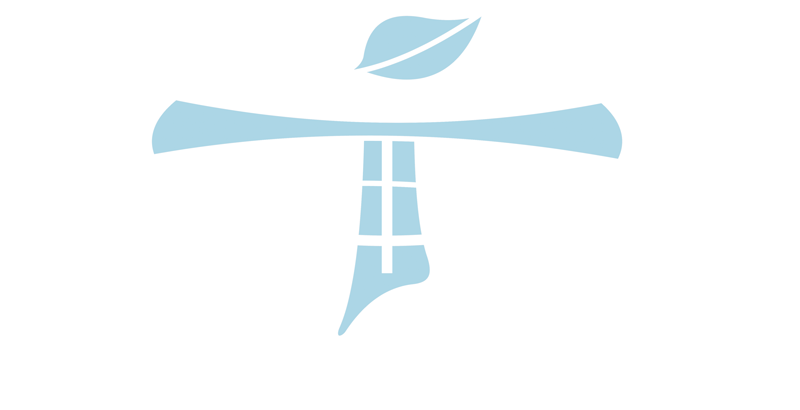
Neueste Kommentare