Bei den Krankheiten blieb es allerdings nicht. Die Weißen zwangen die Tupari, für sie im Regenwald Kautschuk, also Rohgummi, zu sammeln und an ganz bestimmte Ablieferplätze am Fluss zu bringen, wo die Ware von den Vertretern reicher Kaufleute aus der Amazonasmetro-pole Manaus in Empfang genommen wurde. Die schwere Arbeit bekam den Tupari schlecht, und viele von ihnen starben in der Folgezeit an Misshandlungen, Krankheiten, Hunger und Mord.
Was den Tupari geschah, ereignete sich überall auf dem amerikanischen Kontinent, seitdem Christoph Kolumbus 1492 seinen Fuß in den Sand einer der Bahama-Inseln gesetzt hatte. Ethnologen gehen davon aus, dass damals an die 80 Millionen Indianer in Amerika lebten, darunter zwischen 5 und 8 Millionen allein in Brasilien. Heute sind es im größten Land Latein-amerikas um die 800.000 Indianer, also weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung.
Immerhin hatten die Tupari das Glück, dass sie nicht völlig ausgerottet wurden. Sie leben heute im Bundesland Rondônia im südlichen Bereich Amazoniens im 236.137 ha großen Indianerreservat Rio Branco. Das Reservat, Heimat von etwa 600 Ureinwohnern, wurde 1986 vom brasilianischen Staat errichtet und bietet nicht nur den Tupari eine Überlebenschance, sondern auch einigen anderen kleineren Völkern.
Ende der vierziger Jahre stieß der Schweizer Franz Caspar auf seiner Rückreise von Bolivien nach Europa zufällig auf die Tupari. Eigentlich wollte er nicht lange bleiben, aber dann wur-den es doch zehn Monate, die er unter ihnen lebte. 1952 schrieb er in seinem Buch „Tupari – Unter Indios im Urwald Brasiliens“, wie es dazu gekommen war: „Wie nie zuvor spürte ich, dass mir diese nackten Menschen – anfangs so fremd und oft recht abstoßend – im Laufe der Monate gute Freunde und vertraute Nachbarn geworden waren. Niemand war in diesem mächtigen Hause, der mir nicht in einem hungrigen Augenblicke eine gebratene Wur-zelknolle, eine Papaya-Frucht oder einen Schale Chicha (Maniokbier) mit freundlichem Gruß angeboten hätte. Alle waren auf ihre Art um mein Wohlergehen besorgt, und alle wussten auch, dass ich sie nicht minder lieb gewonnen hatte.“
Damals entstanden die Schwarzweißphotos dieser Ausstellung. Im Jahre 2005 besuchte die brasilianische Photographin Gleice Mere die Tupari und nahm dieselben Personen von damals auf. Obwohl sich vieles verändert hat, war auch sie bewegt von der Freundlichkeit dieser Menschen, die so vieles verloren haben – nicht nur das Land, auf dem sie ursprünglich lebten, sondern auch große Teile ihrer alten Kultur, darunter auch ihre Sprache.
Und trotzdem: Nach langer Zeit der Unterdrückung und Not regt sich genauso wie bei vielen anderen Indianervölkern in Brasilien auch unter den Tupari neuer Widerstandsgeist. Gemein-sam mit anderen Völkern kämpfen sie gegen Eindringlinge, die in ihrem Reservat Holz und Bodenschätze stehlen wollen. Gemeinsam mit anderen protestieren sie gegen Veränderungen in ihrer näheren Umwelt, die durch den Bau großer Staudämme verursacht werden.
Text: Bernd Lobgesang, Foto: Heinz Schoenke
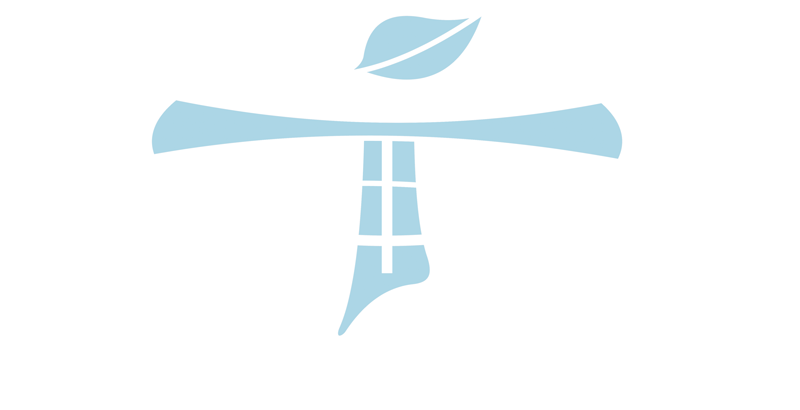
Neueste Kommentare